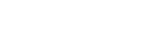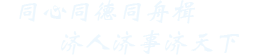Am 10. August endete die 14-tägige Polarsommerschule der Tongji-Universität zum Thema „Klimawandel und Global Governance“ erfolgreich. Die Tongji-Universität gilt als die erste chinesische Hochschule, die ein Praxisteam für wissenschaftliche Forschungen auf Grönland organisiert hat, zu dem neben Bachelor- und Masterstudenten auch Doktoranden gehörten.

Das Praxisteam bestand aus 8 Doktoranden, 10 Masterstudenten und 2 Bachelorstudenten aus dem „Guohao“-Kolleg, dem Kolleg für Bauingenieurwesen, dem Kolleg für Umweltwissenschaften und -engineering, dem Kolleg für Architektur und Stadtplanung, dem Kolleg für Verkehrswissenschaften, dem Kolleg für Elektro- und Informationstechnik, dem Kolleg für chemische Wissenschaft und Engineering, dem Kolleg für Meeres- und Erdwissenschaften, dem Shanghaier Internationalen Kolleg für Geistiges Eigentum sowie dem Kolleg für Kunst und Medien. Das Team bereiste Polarregionen wie Grönland und Island und führte vor Ort Untersuchungen zu den wichtigen Forschungsthemen wie der Bauweise, der Meeresforschung, der Geologie und der Ökologie im Polargebiet durch.

Vielfalt der Polarregionen entdecken
Zum Thema „Polare Bauweise“ führte die Forschungsgruppe für Flughafenrollfeld nach der Ankunft in Nuuk (Grönland) sofort ein Interview mit dem Bodenpersonal und dokumentierte Betriebsdaten der Einrichtungen, um den Betriebszustand der entscheidenden Infrastruktur unter extremen Klimabedingungen systematisch zu erfassen. Bei Untersuchungen in der Stadt erforschten die Mitglieder die Regeln der physischen und psychischen Anpassung der Menschen an die polare Umwelt. Sie nutzten gleichzeitig 3D-Laserscanner, um das Modell des Stadtraums zu sammeln. Im Weiteren kombinierte die Forschungsgruppe dieses Modell mit der Analyse des Fußgängerverhaltens und bot empirische Unterstützung für die Optimierung der Stadtplanung in Polarregionen.

Zum Thema „Polare Meeresforschung“ ging das Team an Bord des Schulschiffs „Statsraad Lehmkuhl“ – bekannt als „die Universität auf dem Wasser“ – und führte während einer Forschungsfahrt in den Gewässern Grönlands die Beobachtung zum Zustand von Meereis und zu Strömungscharakteristika durch. Gemeinsam mit einem Praxisteam aus Norwegen wurden Oberflächenwasserproben in Fjorden gesammelt und vor Ortbearbeitet und analysiert . Dadurch wurde der Forschungsumfang der Verschmutzung durch Mikroplastik von Küstenregionen auf das offene Meer ausgeweitet. Gleichzeitig gelang es dem Forschungsteam, eine synchronisierte Probenentnahme mit der chinesischen Arktis-Forschungsstation „Huanghe-Fluss“ durchzuführen, was die Grundlage für vergleichbare überregionale Umweltforschungen legte.

Zum Thema „Polarenergie und -geologie“ besuchte das Team auf Island die Wasserkraftwerke Burfellsvirkjun und Sultartangar, um systematisch das regenerative Energiesystem aus Windkraft, Wasserkraft und Geothermie kennenzulernen. Am Vatnajökull-Gletscher ließ sich der durch die Klimaerwärmung verursachte Gletscherschwund direkt beobachten. Am Jökulsárlón-Gletschersee und am Diamantstrand beobachtete man Seehundaktivitäten, analysierte die Eisbergverteilung und erforschte die Küstentidenkinetik. Auf dem Schwarzen Strand erkundete das Team die Erosionslandschaften und die Papageienbrutplätze und vertiefte die Verbindung von geologischen Forschungen und ökologischen Überlegungen.

Zum Thema „Polare Ökologie“ informierte sich das Team im isländischen Forschungszentrum Sudurnes über die Arbeit wie die Untersuchung mariner Wirbelloser sowie die Überwachung invasiver Arten und führte intensive Gespräche mit den Forschern. Im Lavafeld Dimmuborgir bei Akureyri durchquerten die Mitglieder Lavatunnel, berührten Gletscherschrammen und analysierten die mineralische Zusammensetzung des Vulkangesteins sowie die Mechanismen der geomorphologischen Entwicklung. Im Hafen von Reykjavík verwendeten die Mitglieder die Idee der Koexistenz des Hafenstadtzentrums als Überlegung zur nachhaltigen Entwicklung.
Bei der Besichtigung der polaren Museen und Stätten des Welterbes verfolgte das Team zudem zeitübergreifend die humanistische Spur der Vergangenheit.

Das immersive Erlebnis im historischen Museum Grönlands ermöglichte den Studierenden ein vertieftes Verständnis für das soziale Gefüge, die Umweltfragen und die gesellschaftlichen Anliegen im Grönland der Gegenwart. Im Nationalmuseum Islands erarbeitete sich die Gruppe aus verschiedenen Perspektiven ein umfassendes Bild von der Entwicklung dieser Region. In Akureyri zeigte das Museum Glaumbær in Form von Torfhäusern die enge Verbindung zwischen traditioneller Bauweise und Natur. Das „Viking House“ verkörperte die ökologische Philosophie der nordischen Baukultur, in der die Menschen den Naturgesetzen folgen und die Natur rational nutzen, und bot damit wertvolle Inspiration für zeitgenössische nachhaltige Architektur.
Die Kooperationsvision gemeinsam schaffen
Auf dem Symposium „Arctic Frontiers“ in Grönland versammelten sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt, um über die Folgen des Klimawandels für Grönland, den wissenschaftlichen Wert des indigenen traditionellen Wissens sowie Wege der nachhaltigen Ressourcennutzung zu diskutieren. Mit Forschern aus Norwegen, Schweden, Deutschland und anderen Ländern gingen die Teammitglieder intensiv auf Themen wie „Vernetzung indigenen Wissens mit moderner Forschung“ und „die Rolle junger Wissenschaftler in der Arktis-Governance“ ein.


An der Universität Islands stellten die Tongji-Universität und die Universität Islands ihre Forschungsergebnisse im Energiebereich vor. In der Zukunft wollen beide Seiten ihre Zusammenarbeit in Schlüsselbereichen wie Polarforschung und erneuerbare Energien vertiefen und durch den Austausch akademischer Ressourcen sowie die gemeinsame Nachwuchsförderung innovative Beiträge zu globaler Klimagovernance und nachhaltiger Entwicklung leisten.

Am chinesisch-isländischen Polarlicht-Observatorium tauschte sich das Team mit Expertinnen und Experten zu Themen wie isländischen Wasseraufbereitungstechnologien, psychischer Gesundheit in den Wohnumgebungen von Forschungsstationen und rechtlichen Fragen der Arktis-Governance aus und gewann Einblicke in die bewährte internationale Kooperationspraxis des Observatoriums.
An der Universität von Grönland sowie an der Universität Akureyri diskutierten beide Seiten über die besonderen Herausforderungen und Chancen der arktischen Forschung. Beim Austausch mit dem International Arctic Science Committee lernte das Team systematisch dessen Arbeitsweise und globale Kooperationsmodelle in der Arktisforschung kennen.
„Auf unserem Weg haben wir die Weisheit der harmonischen Koexistenz von Mensch und Natur tief gespürt“, erklärten die Studierenden. „Diese Exkursion hat unser Verständnis und unsere Überlegung zur multidisziplinären Arktisforschung erheblich vertieft, eine solide Grundlage für die Durchführung weiterer Forschungsprojekte geschaffen und unseren Entschluss gestärkt, nämlich mit unserem Fachwissen aktiv zur globalen Klimagovernance beizutragen.“